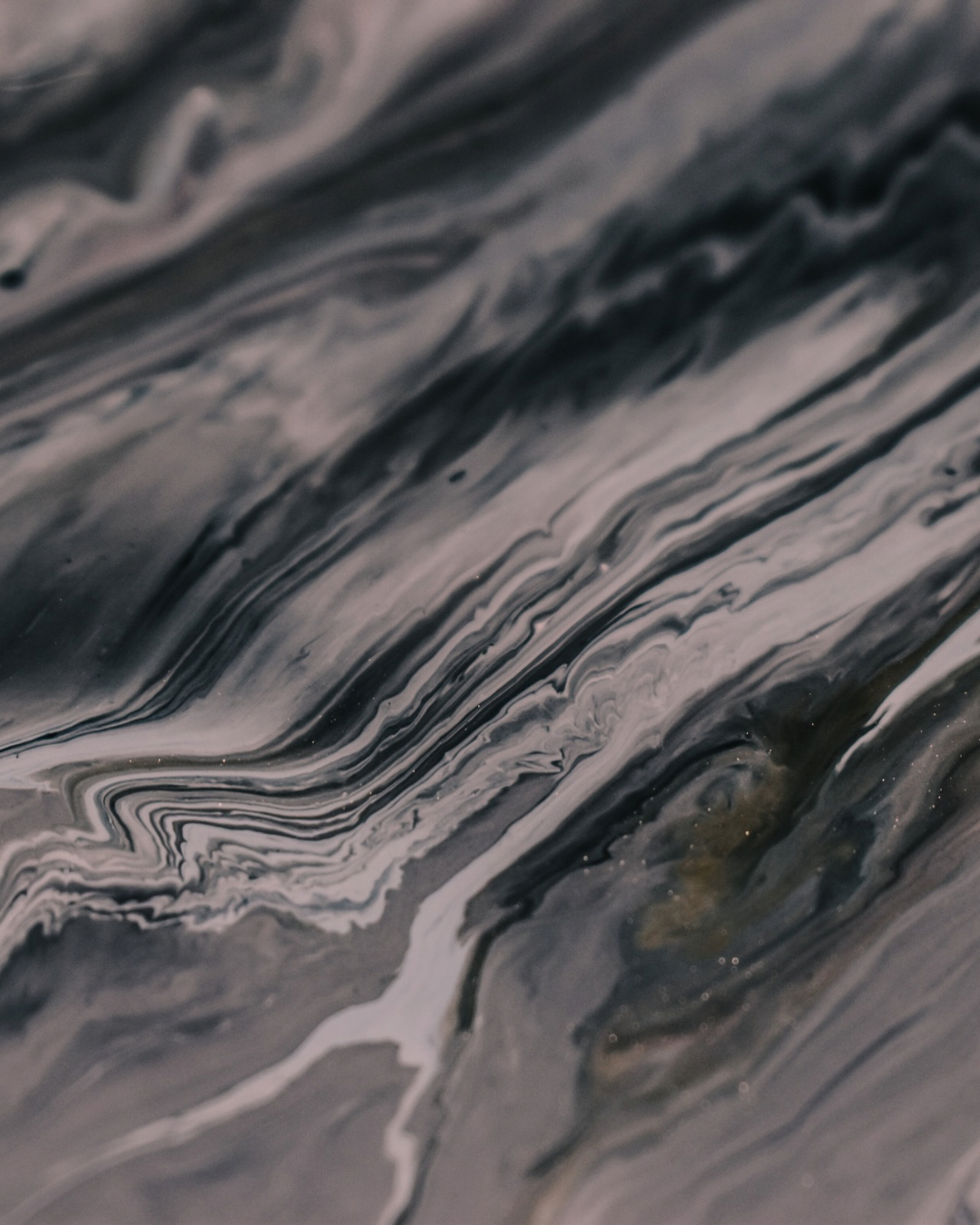Wenn ich Grenzen setze, fühlt es sich jedes Mal so an, als würde ich den anderen nicht mehr lieben.
Aber wenn ich keine setze, liebe ich mich nicht mehr.
Ich darf lernen, dass ich auch liebe, wenn ich nicht immer verfügbar bin.
Wenn ich nicht immer alles abnehme.
Wenn ich mein eigenes mache – auf meine Art.
So, wie es mir guttut.
Ich darf gerade so viel lernen – und das ist so ungewohnt, so fremd, so wackelig!
Ich hatte eine Mama, die mir keine Grenzen gesetzt hat – und meine ständig überschritten hat.
Ihre Strafe war Ablehnung und Ausschluss.
So wollte ich niemals werden.
Also wurde ich zu einer Mama, die selbst keine Grenzen hatte.
Die die Grenzen anderer oft überschritt, immer verfügbar war – und sich dabei selbst aufgab.
Jetzt darf ich lernen, wie ein gesunder Weg aussieht.
Mit mir selbst.
Ohne Vorbild.
Nur durch mein eigenes Erfahren und Bewusstwerden.
Ich darf stolz auf mich sein –
und meiner Mama und mir vergeben,
für das, was wir beide für Liebe hielten und wie wir sie lebten.
Denn wir wollten beide nur eines: lieben und geliebt werden.
Ich darf liebevolle Grenzen für mich setzen.
Nicht eingreifen – sondern präsent da sein.
Das ist meine Form von Liebe: Annahme und Präsenz.
Nicht immer verfügbar sein,
nicht alles übernehmen,
sondern andere – und mich – annehmen, wie wir sind.
Einfach da sein.
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch nicht, wie ich das leben und verkörpern soll.
Aber ich werde es herausfinden.
Bisher habe ich mich immer angeboten.
Wenn meine Kinder nicht reagiert haben, bin ich zu ihnen vorgedrungen – in ihren Raum hinein – und habe mich aufgedrängt.
Jetzt übe ich mich darin, stehen zu bleiben.
Ich bin zu weit gegangen – und komme wieder zu mir zurück.
Aber in mir ist noch Gefahr.
Das spüre ich.
Wenn ich mich von anderen löse und es klappt, freue ich mich –
doch ein Teil in mir lässt mich noch nicht einfach bei mir sein.
Den Raum, der dann entsteht, fülle ich nicht mit Sein, sondern mit Tun.
Mit Leisten.
Ich übersteuere.
In mir gibt es nur zwei Bewegungen:
mich für andere aufopfern – oder leisten.
Dazwischen herrscht Alarm.
Bei mir zu sein ist noch unsicher, ungewiss, unkontrollierbar.
Da war ich noch nie.
Da entsteht Neuland.
Ich habe nur meine Instinkte.
Ich brauche Präsenz –
im Hier und Jetzt, auf Erden, in mir.
Präsenz ist eine wundervolle Gabe, die ich habe.
Und doch erkenne ich heute: Sie ist noch nicht ganz freigeschaltet.
Etwas in mir sagt noch:
„Geh weiter, schau nicht hin, mach was anderes.“
Etwas in mir schützt mich noch davor – mein Kontrollfreak.
Aber sie kommt näher –
die Präsenz, der Raum, in dem ich Kontrolle abgebe.
Ich kann sie heute spüren.
Ich spüre heute so viel.
Als würden viele kleine Flüsse zusammenfinden –
ins Meer der unendlichen Möglichkeiten.